
- Details
- Geschrieben von: Moritz Conjé
- Kategorie: Gesellschaft
Die zunehmende Verdichtung von Städten und die wachsende Nachfrage nach schnellen Transportlösungen führen dazu, dass auch der Luftraum stärker in den Fokus rückt. Drohnen und elektrische Luftfahrzeuge gelten als ein möglicher Baustein zukünftiger Mobilität – sei es für Lieferdienste, Notfalltransporte oder neue Formen des Personenverkehrs. Damit solche Technologien sicher und effizient eingesetzt werden können, sind Testumgebungen notwendig, die den Betrieb im städtischen Kontext realistisch abbilden.
M-Air: Ein Testkorridor für die Luftmobilität der Zukunft
Im August 2025 hat der US-Bundesstaat Michigan ein neues Forschungsprojekt angekündigt: M-Air, einen 40 Meilen langen Drohnen-Testkorridor. Finanziert mit einer Million US-Dollar aus Landesmitteln und betrieben in Zusammenarbeit mit der University of Michigan, soll dieser Korridor die Entwicklung und Erprobung von Drohnen- und E-Luftmobilitätsanwendungen vorantreiben - University of Michigan News
Die Besonderheit von M-Air liegt in seinem Fokus auf Beyond Visual Line-of-Sight (BVLOS)-Flüge. Während die meisten Drohnentests bislang auf Sichtweite beschränkt waren, ermöglicht der Korridor eine realitätsnähere Erprobung von Anwendungen, die für den praktischen Einsatz entscheidend sind – beispielsweise Lieferungen über längere Distanzen.
Forschung und Infrastruktur im Zusammenspiel
Mit M-Air sollen verschiedene Fragen adressiert werden:
- Technologie: Wie lassen sich Drohnen sicher in bestehende Luftraumstrukturen integrieren?
- Infrastruktur: Welche Bodenstationen, Kommunikationsnetze und Ladepunkte sind erforderlich, um den Betrieb zuverlässig zu gestalten?
- Regulierung: Welche Standards und Zulassungsverfahren braucht es, um den kommerziellen Betrieb zu ermöglichen?
Die Einbindung der University of Michigan stellt sicher, dass neben der Technikentwicklung auch wissenschaftliche Begleitforschung betrieben wird – etwa zu Sicherheit, gesellschaftlicher Akzeptanz oder ökologischen Auswirkungen.
Bedeutung für die Region Michigan
Für Michigan, das sich in den letzten Jahren als Standort für innovative Mobilitätsprojekte positioniert hat, ist M-Air ein weiterer Schritt, um die eigene Rolle als Testfeld für zukünftige Transportlösungen auszubauen. In Kombination mit bestehenden Programmen im Bereich der Automobil- und Batterietechnik kann die Region so ein umfassendes Innovationsökosystem etablieren.
Zudem eröffnet der Korridor lokalen Unternehmen und Start-ups die Möglichkeit, neue Anwendungen unter realen Bedingungen zu erproben – von Logistikdiensten bis hin zu medizinischen Transportlösungen.
Ausblick
Mit M-Air entsteht ein Modellprojekt, das über Michigan hinausstrahlen könnte. Wenn Drohnenlieferungen, autonome Lufttaxis oder neue Formen der Infrastrukturplanung Realität werden sollen, braucht es genau solche Testumgebungen. Der Korridor ist damit nicht nur ein Beitrag zur technologischen Entwicklung, sondern auch ein Schritt hin zu einer möglichen Integration von Luftmobilität in den Alltag zukünftiger Städte.
Zusammenfassung
Michigan hat mit M-Air einen Drohnen-Testkorridor angekündigt, der Forschung, Infrastruktur und Regulierung zusammenführt. Das Projekt ermöglicht realitätsnahe Tests von Drohnen außerhalb der Sichtweite und unterstützt damit die Weiterentwicklung urbaner Luftmobilität. Es zeigt, wie gezielte Investitionen in Testumgebungen den Weg für neue Verkehrstechnologien ebnen können.

- Details
- Geschrieben von: Moritz Conjé
- Kategorie: Gesellschaft
Städte im Wandel: Daten als Grundlage moderner Verwaltung
Städte weltweit stehen vor zunehmenden Herausforderungen: wachsende Bevölkerungszahlen, Klimawandel, Ressourcenknappheit und steigende Anforderungen an öffentliche Dienstleistungen. Um diese Aufgaben zu bewältigen, wird die Fähigkeit, Daten systematisch zu erfassen und auszuwerten, immer wichtiger. Daten werden so zur grundlegenden Infrastruktur moderner Stadtentwicklung.
Gleichzeitig fehlt es vielen Kommunen an Kapazitäten, um Daten aus unterschiedlichen Fachbereichen zusammenzuführen und mit modernen Methoden wie künstlicher Intelligenz auszuwerten. Hier setzt die Bloomberg City Data Alliance an.
Die Bloomberg City Data Alliance im Überblick
Die Initiative wurde von Bloomberg Philanthropies gegründet, um Städte weltweit beim Aufbau von Daten- und KI-Kompetenzen zu unterstützen. Teilnehmende Städte erhalten:
- Coaching und Beratung, um datengetriebene Entscheidungsprozesse aufzubauen,
- technische Unterstützung, etwa beim Aufbau von Datenplattformen,
- und Zugang zu einem Netzwerk, das bewährte Verfahren austauscht und skaliert.
Im August 2025 wurde das Netzwerk erneut erweitert: Mit Austin, Boston, Dallas, Denver, Kansas City (MO) und Newport News (VA) traten sechs weitere US-Städte bei. Insgesamt traten weitere 9 Städte aus Kanada, Brasilien, Chile und Komlumbien bei. Damit umfasst die Allianz nun 80 Städte in 12 Ländern - Smart Cities Dive & Johns Hopkins University
Konkrete Anwendungsfelder
Die Allianz unterstützt Städte dabei, Daten nicht nur zu sammeln, sondern sie in konkrete Maßnahmen umzusetzen. Beispiele für mögliche Anwendungsfelder:
- Verkehrsmanagement: Analyse von Echtzeitdaten zur Steuerung von Ampelschaltungen und Reduzierung von Staus.
- Energieeffizienz: Nutzung von Verbrauchsdaten, um Lastspitzen abzufedern und Stromnetze resilienter zu gestalten.
- Gesundheit & Umwelt: Erhebung von Indikatoren, um präventive Maßnahmen besser auszurichten.
- Soziale Gerechtigkeit: Entwicklung von Metriken, die ungleiche Lebensbedingungen sichtbar machen und politische Maßnahmen steuern.
Durch den Zusammenschluss profitieren die beteiligten Städte von gemeinsamen Standards und voneinander erprobten Lösungsansätzen.
Bedeutung für die urbane Entwicklung
Mit der Aufnahme weiterer Städte wird deutlich, dass datenbasierte Verwaltung nicht mehr als Option, sondern als notwendige Grundlage betrachtet wird. Die Allianz ist dabei mehr als ein technisches Programm: Sie etabliert Datenkompetenz als Teil kommunaler Governance und schafft eine Basis für Transparenz, Wirkungskontrolle und langfristige Planung.
Ausblick
Die nächste Entwicklungsstufe wird sein, diese Datenstrukturen in digitale Stadtzwillinge (Connected Urban Twins) einzubinden. Auf dieser Grundlage lassen sich Szenarien in Echtzeit simulieren – von Verkehrsströmen über Energieverbräuche bis hin zu Klimafolgen. Die Bloomberg City Data Alliance legt mit ihrem Fokus auf Datenqualität und Governance den Grundstein für diesen Schritt.
Zusammenfassung
Die Bloomberg City Data Alliance wächst auf 80 Städte weltweit an. Sie unterstützt Kommunen darin, Daten systematisch zu nutzen und KI-Anwendungen verantwortungsvoll einzusetzen. Der Zusammenschluss verdeutlicht: Datenkompetenz ist ein zentrales Element moderner Stadtentwicklung und Voraussetzung für resiliente, lebenswerte Städte.
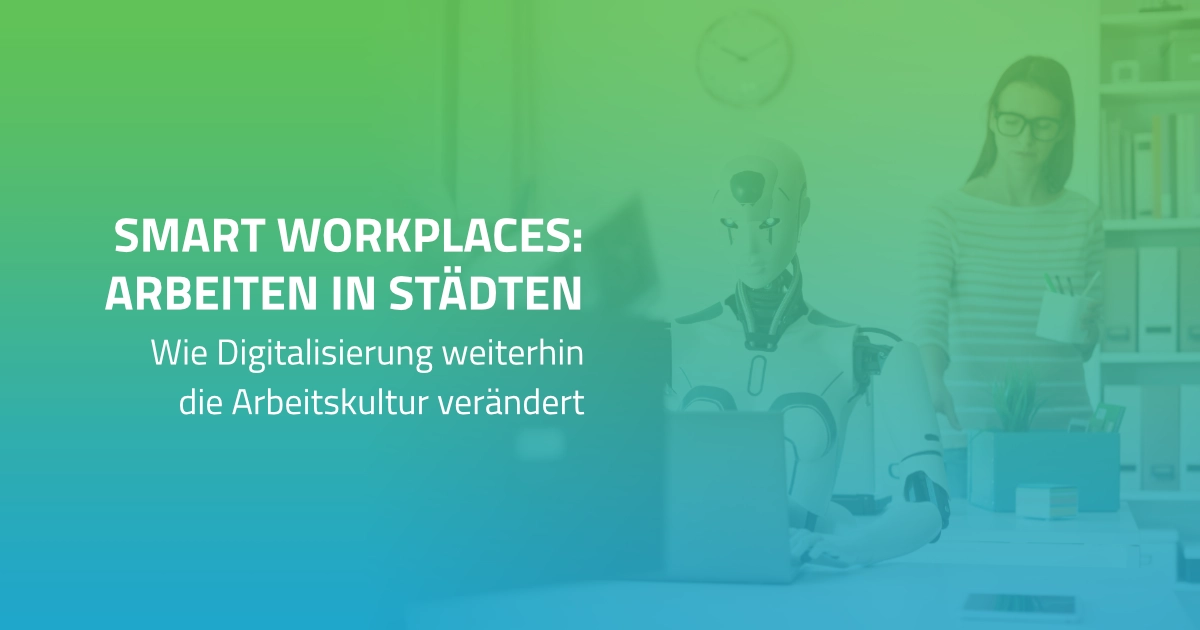
- Details
- Geschrieben von: Moritz Conjé
- Kategorie: Gesellschaft
Die Digitalisierung hat nicht nur unsere Städte, sondern auch unsere Arbeitskultur grundlegend verändert. Mit dem Aufkommen von Smart Workplaces verschmelzen physische und digitale Arbeitswelten, was neue Herausforderungen und Chancen für Unternehmen und Mitarbeitende mit sich bringt.
Was sind Smart Workplaces?
Smart Workplaces sind intelligente Arbeitsumgebungen, die durch den Einsatz moderner Technologien wie dem Internet der Dinge (IoT), künstlicher Intelligenz (KI) und Cloud-Computing eine flexible, effiziente und kollaborative Arbeitsweise ermöglichen. Sie sind ein zentraler Bestandteil der Smart City-Entwicklung und tragen dazu bei, die Lebensqualität und Produktivität in urbanen Räumen zu steigern.
Beispielsweise können durch die Integration von IoT-Sensoren in Bürogebäuden Echtzeitdaten über Raumbelegung, Luftqualität und Energieverbrauch erfasst werden. Diese Daten ermöglichen es, Arbeitsplätze bedarfsgerecht zu gestalten und Ressourcen effizient zu nutzen. Zudem fördern digitale Plattformen die Zusammenarbeit über verschiedene Standorte hinweg und unterstützen hybride Arbeitsmodelle.
Die Rolle der Digitalisierung in der Arbeitskultur
Die Digitalisierung verändert die Art und Weise, wie wir arbeiten, kommunizieren und zusammenarbeiten. Sie ermöglicht ortsunabhängiges Arbeiten, fördert die Work-Life-Balance und schafft neue Formen der Zusammenarbeit. Gleichzeitig stellt sie Unternehmen vor die Herausforderung, ihre Unternehmenskultur und Führungsstile an die neuen Gegebenheiten anzupassen.
Ein zentrales Element ist die Einführung flexibler Arbeitsmodelle, die sowohl Präsenz- als auch Remote-Arbeit ermöglichen. Dies erfordert nicht nur technologische Anpassungen, sondern auch eine Veränderung der Unternehmenskultur hin zu mehr Vertrauen und Eigenverantwortung. Führungskräfte müssen lernen, Ergebnisse statt Präsenz zu bewerten und Mitarbeitende in ihrer Selbstorganisation zu unterstützen.
Beispiele für Smart Workplaces in Städten
In Deutschland gibt es bereits zahlreiche Beispiele für die erfolgreiche Umsetzung von Smart Workplaces:
- München: Das Unternehmen NTT DATA hat in München ein intelligentes Büro eingerichtet, das hybride Arbeitsmodelle unterstützt. Durch die Integration von Videokonferenzsystemen und digitalen Zwillingen zur Raumbelegung können Mitarbeitende flexibel arbeiten und gleichzeitig effizient kommunizieren. global.ntt
- Hamburg: In Hamburg wird die Digitalisierung der Arbeitswelt aktiv vorangetrieben. Die Stadt investiert in digitale Infrastrukturen und fördert Projekte, die die Zusammenarbeit und Kommunikation in der Verwaltung verbessern. wolfsburg.de
- Köln: Das Projekt „un:box“ in Köln erprobt neue Formen der Bürgerbeteiligung und Arbeitskultur, die auf Digitalisierung und Flexibilität setzen. Durch temporäre Interventionen im Stadtraum werden innovative Arbeits- und Beteiligungsformate getestet.
Herausforderungen und Chancen
Während Smart Workplaces viele Vorteile bieten, gibt es auch Herausforderungen:
- Datenschutz und Sicherheit: Die Integration neuer Technologien erfordert robuste Sicherheitsmaßnahmen, um sensible Unternehmensdaten zu schützen.
- Mitarbeiterakzeptanz: Nicht alle Mitarbeitenden sind sofort bereit, neue Technologien zu nutzen. Es bedarf Schulungen und einer offenen Kommunikation, um Akzeptanz zu schaffen.
- Infrastruktur: Eine zuverlässige digitale Infrastruktur ist Voraussetzung für die erfolgreiche Implementierung von Smart Workplaces. Dies umfasst sowohl die technische Ausstattung als auch stabile Internetverbindungen.
Trotz dieser Herausforderungen bieten Smart Workplaces die Chance, eine moderne, flexible und produktive Arbeitsumgebung zu schaffen, die den Anforderungen der heutigen Arbeitswelt gerecht wird.
Smart Workplaces in Smart Cities
Smart Cities basieren auf der Idee, dass urbane Räume durch den intelligenten Einsatz digitaler Technologien lebenswerter, nachhaltiger und effizienter werden. In diesem Kontext spielen Smart Workplaces eine zentrale Rolle – sie sind nicht nur Orte der Produktivität, sondern integraler Bestandteil des digitalen Ökosystems Stadt.
Laut forbes.at fungiert der Arbeitsplatz zunehmend als „Knotenpunkt im urbanen Netzwerk“. In einem smarten Stadtkontext ist der Arbeitsplatz kein isolierter Raum mehr, sondern eng mit Mobilitätslösungen, Energieversorgung, urbaner Logistik und digitalen Services verzahnt. Mitarbeitende pendeln nicht mehr zwingend in die Zentrale, sondern nutzen ein Netzwerk aus flexibel buchbaren, dezentralen Arbeitsorten. Diese werden dynamisch mit Echtzeitdaten gesteuert – etwa durch Auslastungsanzeigen, Buchungssysteme oder smarte Gebäudeleittechnik.
Auch regionalhero.com unterstreicht: Smart Workplaces sind nicht nur technologisch aufgerüstete Büros, sondern Orte, an denen Arbeit neu gedacht wird – kollaborativ, partizipativ und nutzerzentriert. Sie fördern Kommunikation über Abteilungs- und Unternehmensgrenzen hinweg, binden urbane Innovationsnetzwerke mit ein und orientieren sich an den Bedürfnissen der Menschen, die dort arbeiten. Dies zeigt sich u. a. an den Schnittstellen zur Stadtentwicklung: Shared Spaces in Quartierszentren, Büros in Mobilitäts-Hubs, Meetingräume im Kulturzentrum oder Coworking in Bibliotheken.
Der Nutzen liegt auf der Hand:
- Effizienz: Durch intelligent vernetzte Systeme werden Flächen- und Energieressourcen besser genutzt.
- Lebensqualität: Pendelzeiten sinken, die Work-Life-Balance verbessert sich.
- Innovation: Der Arbeitsplatz wird zum Impulsgeber für neue Ideen – vernetzt mit Stadtgesellschaft, Start-ups und Forschung.
- Nachhaltigkeit: Smart Buildings und flexible Nutzungskonzepte sparen Emissionen und fördern den Umwelt- und Ressourcenschutz.
Smart Workplaces sind also ein zentraler Hebel, um Städte zukunftsfähig zu machen – sie verbinden die Ziele von Stadtplanung, Digitalisierung sowie die Gestaltung der Arbeitsplätze im Sinne des Menschen um in einem ganzheitliche Ökosystem alle Synergien nutzen zu können.
Fazit
Smart Workplaces sind mehr als nur ein Trend – sie sind eine notwendige Entwicklung in der modernen Arbeitswelt. Durch die Kombination von Technologie, Flexibilität und einer offenen Unternehmenskultur können Städte und Unternehmen eine Arbeitsumgebung schaffen, die sowohl produktiv als auch menschenzentriert ist.
Für Unternehmen bedeutet dies, nicht nur in Technologie zu investieren, sondern auch in die Weiterentwicklung ihrer Unternehmenskultur und Führungsstile. Nur so können die Vorteile der Digitalisierung der Arbeitswelt erfolgreich gestaltet und Herausforderungen und Riskine minimiert werden.
Ein absolutes "Zurück" wird es nicht mehr geben, egal, wie sehr sich einige Unternehmen dies wünschen.
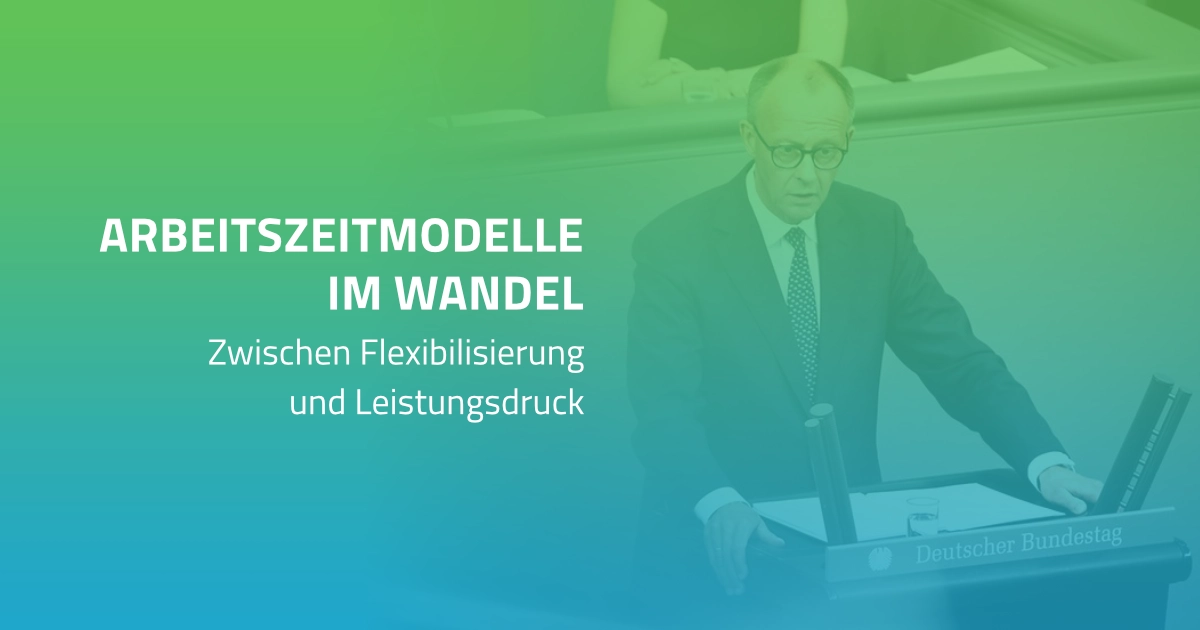
- Details
- Geschrieben von: Moritz Conjé
- Kategorie: Gesellschaft
1. Einleitung: Mehr als nur Stunden – Arbeitszeit im Wandel
Hand aufs Herz, kaum etwas beeinflusst unser Leben so direkt wie unsere Arbeitszeit. Es geht nicht nur darum, wie viel Geld am Ende des Monats auf dem Konto landet. Es geht darum, wann wir Zeit für unsere Familie haben, unseren Hobbys nachgehen können oder einfach mal die Seele baumeln lassen. Ob wir genug schlafen, Sport machen oder uns gesund ernähren können – all das hängt eng mit unserer Arbeitszeit zusammen.
Deshalb ist es so wichtig, dass sich in diesem Bereich etwas bewegt. Und genau das tut es gerade: Die neue Regierung unter CDU-Führung plant mit ihrem Koalitionsvertrag 2025 eine größere Reform der Arbeitszeitregelungen. Es geht um flexiblere Arbeitszeitmodelle, neue Regeln für die Erfassung unserer Stunden und eine stärkere Orientierung an der Wochenarbeitszeit statt an starren Tagesgrenzen.
Als jemand, der sich beruflich mit modernen Arbeitswelten beschäftigt, finde ich das super spannend. Es ist ein Thema, das uns alle angeht – egal ob wir im Büro sitzen, im Homeoffice arbeiten oder ständig unterwegs sind.
2. Kurzer Trip in die Vergangenheit: Von der Fabrik zur flexiblen Arbeit
Früher war alles einfacher – zumindest in Bezug auf die Arbeitszeit. Das Standardmodell in Deutschland sah so aus: acht Stunden am Tag, fünf Tage die Woche, macht 40 Stunden insgesamt. Diese Struktur hat uns lange gute Dienste geleistet, nicht zuletzt aus Gründen des Arbeitsschutzes. Sie wurde in der Zeit der Industrialisierung eingeführt, als wichtige Verbesserung gegenüber den damaligen Arbeitsbedingungen mit oft zwölf Stunden am Tag und Arbeit sogar am Sonntag.
Aber dann kam die Digitalisierung. Mit Laptops, Smartphones und der Möglichkeit, von überall aus zu arbeiten, wurden die starren Arbeitszeitmodelle langsam brüchig. Wie soll man Homeoffice, Projektarbeit oder Dienstreisen in feste Zeitrahmen pressen? Das passt einfach nicht mehr zusammen.
Schon die Vorgängerregierung hatte nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs im Jahr 2019 angekündigt, dass die Arbeitszeiterfassung verpflichtend werden soll. Aber die Umsetzung zog sich hin – auch weil Corona, die Diskussion um New Work und wirtschaftliche Unsicherheiten dazwischenkamen.
Die klassischen Acht-Stunden-Tage passen irgendwie nicht mehr in unsere Zeit. Unsere Arbeitswelt hat sich durch die Digitalisierung einfach zu stark verändert. Und die Gesetze hinken der Realität noch hinterher.
3. Die Pläne der Regierung für 2025: Mehr Freiheit, weniger Zwang
Die aktuelle Regierung will nun mehr Eigenverantwortung und Flexibilität ermöglichen. Die wichtigsten Punkte sind:
- Wochenarbeitszeit statt täglicher Höchstarbeitszeit: Das bedeutet, dass wir unsere Arbeitszeit flexibler über die Woche verteilen können. Wenn wir an einem Tag mehr arbeiten, können wir an einem anderen Tag früher Feierabend machen.
- Digitale Arbeitszeiterfassung: Künftig sollen wir unsere Arbeitszeit digital erfassen – und zwar auch im Homeoffice.
- Vertrauensarbeitszeit mit Zielvereinbarungen: Hier gibt es eventuell Ausnahmen von der Zeiterfassungspflicht. Stattdessen sollen wir mit unseren Vorgesetzten Ziele vereinbaren und unsere Arbeit selbstständig einteilen.
Die Arbeitgeber finden die Flexibilisierung gut. Gewerkschaften und Arbeitsmediziner warnen hingegen vor zu viel Druck und einem Verschwimmen der Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit.
Also, die Regierung will weg von der täglichen Höchstarbeitszeit und hin zu einem Wochenmodell. Die Arbeitszeiterfassung soll digital und verpflichtend werden. Während die Arbeitgeber darin Chancen sehen, befürchten die Gewerkschaften Risiken für unsere Gesundheit.
4. Ein Blick auf die Vielfalt: Moderne Arbeitszeitmodelle im Vergleich
Die Arbeitswelt ist heute viel bunter als der klassische Job von neun bis fünf. Es gibt viele verschiedene Modelle, die sich in der Praxis bewährt haben:
- Gleitzeit, Vertrauensarbeitszeit und die Vier-Tage-Woche sind nur einige Beispiele.
- Auch Jobsharing, Teilzeitmodelle und Remote-First- oder Hybrid-Modelle werden immer beliebter.
Studien zeigen, dass Flexibilität zu mehr Zufriedenheit führen kann – allerdings nur, wenn es klare Regeln und Rahmenbedingungen gibt.
Gleitzeit, Vertrauensarbeit und die Vier-Tage-Woche sind die großen Trends. Flexible Modelle können unsere Motivation und Effizienz steigern. Aber wichtig ist, dass alle gut miteinander kommunizieren und Vertrauen herrscht.
5. Licht und Schatten: Die Chancen und Risiken der Flexibilisierung
Flexibilität bedeutet Freiheit, aber auch Verantwortung. Wer seine Arbeitszeit selbst einteilen kann, hat mehr Lebensqualität. Aber es gibt auch Risiken wie die schon erwähnte Entgrenzung, Selbstausbeutung und gesundheitliche Probleme.
Flexibilität kann uns helfen, unser Leben besser zu gestalten, oder uns in Stress stürzen – es kommt darauf an, wie wir damit umgehen. Selbstausbeutung ist dabei eine echte Gefahr. Deshalb müssen Unternehmen klare Regeln aufstellen und eine Kultur schaffen, in der wir auf uns achten.
6. Was gerade passiert: Die Politik diskutiert weiter
Im Juni 2024 hat die CDU/CSU einen Antrag in den Bundestag eingebracht, mit dem Ziel, die Arbeitszeit zu flexibilisieren und den Beschäftigten mehr Freiheit zu geben. Konkret ging es um die Umstellung auf eine wöchentliche Höchstarbeitszeit. Der Antrag wurde jedoch abgelehnt, weil die anderen Parteien Sorge hatten, dass der Arbeitsschutz darunter leiden könnte.
Obwohl der Antrag abgelehnt wurde, ist das Thema noch lange nicht vom Tisch. Die Diskussionen über eine Reform des Arbeitszeitgesetzes gehen weiter.
Die CDU/CSU wollte die wöchentliche Höchstarbeitszeit einführen, ist aber im Bundestag gescheitert. Die Bedenken zum Schutz der Arbeitnehmer waren zu groß. Aber das Thema bleibt wichtig und wird weiter diskutiert.
7. Fazit: Ein guter Schritt, aber mit Köpfchen
Die Diskussion um die Arbeitszeit 2025 zeigt, dass wir an einem Wendepunkt stehen. Die Regierung bewegt etwas – und das ist grundsätzlich gut. Aber Flexibilisierung darf nicht bedeuten, dass wir uns kaputtarbeiten. Wir brauchen Schutzmechanismen, clevere Technik und eine offene Kommunikation.
Ich finde die neuen Möglichkeiten gut, sehe aber auch, dass wir alle Verantwortung übernehmen müssen. Wir müssen lernen, mit der Flexibilität umzugehen. Nur so wird aus unserer Arbeitszeit auch wirklich Lebenszeit.
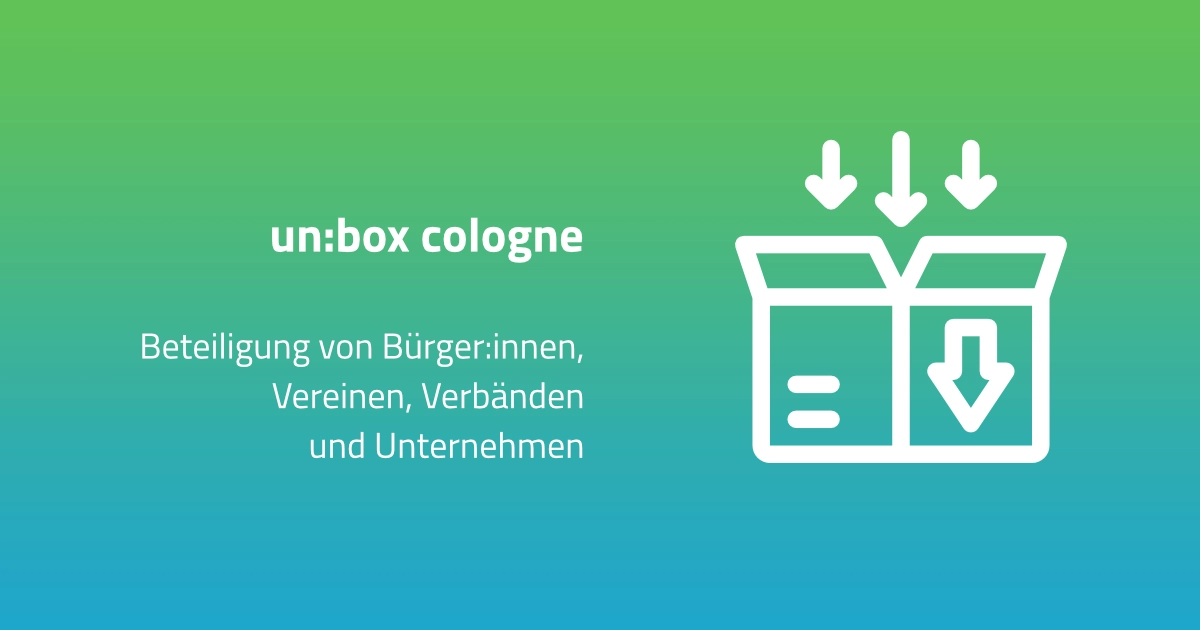
- Details
- Geschrieben von: Moritz Conjé
- Kategorie: Gesellschaft
Warum Bürgerbeteiligung heute neu gedacht werden muss
Viele Kommunen in Deutschland kennen die Herausforderung: Bürgerbeteiligung wird oftmals als langwieriger, bürokratischer Prozess empfunden. Dabei ist eine effektive Einbindung der Bürger entscheidend für die Akzeptanz und den Erfolg von Smart-City-Projekten. Das Projekt „un:box“ aus Köln setzt genau hier an und liefert ein innovatives Beispiel dafür, wie Beteiligung und digitale Transformation heute erfolgreich zusammengedacht werden können.
Was steckt hinter „un:box“?
Das von Railslove initiierte Projekt un:box verfolgt einen bewusst niederschwelligen Ansatz, der Bürgerinnen und Bürger aktiv einbezieht und experimentell vorgeht. Statt großer, teurer Infrastrukturprojekte setzt Köln hier auf kleinere, temporäre Interventionen im Stadtraum, sogenannte „Pop-Up-Projekte“. Diese Experimente werden gemeinsam mit der Bürgerschaft entwickelt und getestet.
Digitale Tools zur Bürgerbeteiligung
Ein entscheidender Erfolgsfaktor von un:box ist der konsequente Einsatz digitaler Technologien. Über digitale Plattformen und Apps können Bürger unkompliziert Vorschläge einreichen, Feedback geben und bei der Umsetzung aktiv mitarbeiten. So entsteht ein echter Dialog zwischen Stadtverwaltung und Bürgerschaft, der transparent, schnell und ergebnisorientiert funktioniert.
Beispiele erfolgreicher digitaler Beteiligung:
- Mein Köln Mitgestalten: Digitale Ideenplattform zur Einreichung und öffentlichen Bewertung von Vorschlägen. Der Nutzen: schnelle, transparente und partizipative Planung. (mein.koeln/)
- Beteiligungs-App „Sag’s uns“: Mobile App zur Meldung von Mängeln und Vorschlägen direkt an die Verwaltung mit unmittelbarer Rückmeldung. Der Nutzen: direkter Dialog und schnelle Problemlösung. (stadt-koeln.de)
- Social-Media-Kampagne #Stadtgestalten: Nutzung von Instagram und Facebook zur Interaktion mit Bürgern und zum Sammeln von Feedback. Der Nutzen: größere Reichweite und niederschwellige Kommunikation. (instagram.com/stadt.koeln)
Schwerpunkte von un:box:
- Grünflächen und Gesundheit im urbanen Raum: Das Projekt fördert gezielt kleine, kurzfristig umsetzbare Maßnahmen zur Verbesserung des Stadtklimas und der Lebensqualität, z. B. urbane Gärten, temporäre Grünanlagen oder Bewegungsangebote im öffentlichen Raum. (railslove.com)
- Förderung sozialer Interaktion und Gemeinschaft: Pop-up-Cafés, Nachbarschaftstreffs und öffentliche Veranstaltungen stärken das Gemeinschaftsgefühl und fördern die soziale Integration vor Ort. (railslove.com)
- Nutzung digitaler Tools für Beteiligung und Feedback: Digitale Plattformen erleichtern den Bürgern das Einreichen von Vorschlägen, deren Bewertung und Feedback in Echtzeit. Dies schafft Transparenz und Vertrauen zwischen Verwaltung und Bürgerschaft. (railslove.com)
Lessons Learned aus Köln
- Schnelligkeit und Sichtbarkeit: Bürger wünschen sich rasche und sichtbare Ergebnisse.
- Experimentierfreude: Mut zu neuen Methoden und Technologien schafft Vertrauen und Innovation.
- Echte Mitgestaltung: Bürger frühzeitig aktiv einbinden, um die Akzeptanz und Nachhaltigkeit der Maßnahmen zu erhöhen.
Was andere Städte von un:box lernen können
- Bürger sollten frühzeitig und kontinuierlich in entsprechende Prozesse und Formate integriert werden.
- Digitale Tools bieten die Möglichkeit, die Menschen gezielt anzusprechen und können strategisch eingesetzt werden.
- Bürgerorientierung dauerhaft etablieren und Partizipation transparent gestalten.
- Es sollte auch im Verlauf Sichtbarkeit und Transparenz geschaffen werden. Nicht nur der initiale Input des Bürgers ist wichtig, sonder auch die "Customer Journey" danach - was passiert mit meinen Input und wie geht es damit weiter? Wie bleibt der Bürger über den Fortschritt und Entscheidungen informiert?
Fazit: Die Zukunft der Bürgerbeteiligung ist digital, flexibel und experimentell
Das Projekt un:box Köln zeigt eindrucksvoll, wie moderne Bürgerbeteiligung aussehen kann und welche positiven Effekte sie für die Stadtgesellschaft bringt. Durch schnelle Experimente, digitale Vernetzung und eine konsequente Orientierung an den Bedürfnissen der Bürger entsteht eine innovative Form des städtischen Miteinanders, die sich flexibel an zukünftige Herausforderungen anpassen lässt.
- Homo Creator: Der schöpferische Mensch im Spiegel der Technik – Ein persönlicher Blick
- Kommunalbefragung 2025 – Ergebnisse und Perspektiven
- „Smart City ist digitale Notwehr“ – Rückblick auf den 6. Kongress der Modellprojekte Smart Cities (MPSC)
- Smart Cities und Stadtentwicklung: Potenziale von Datahubs und Connected Urban Twins










